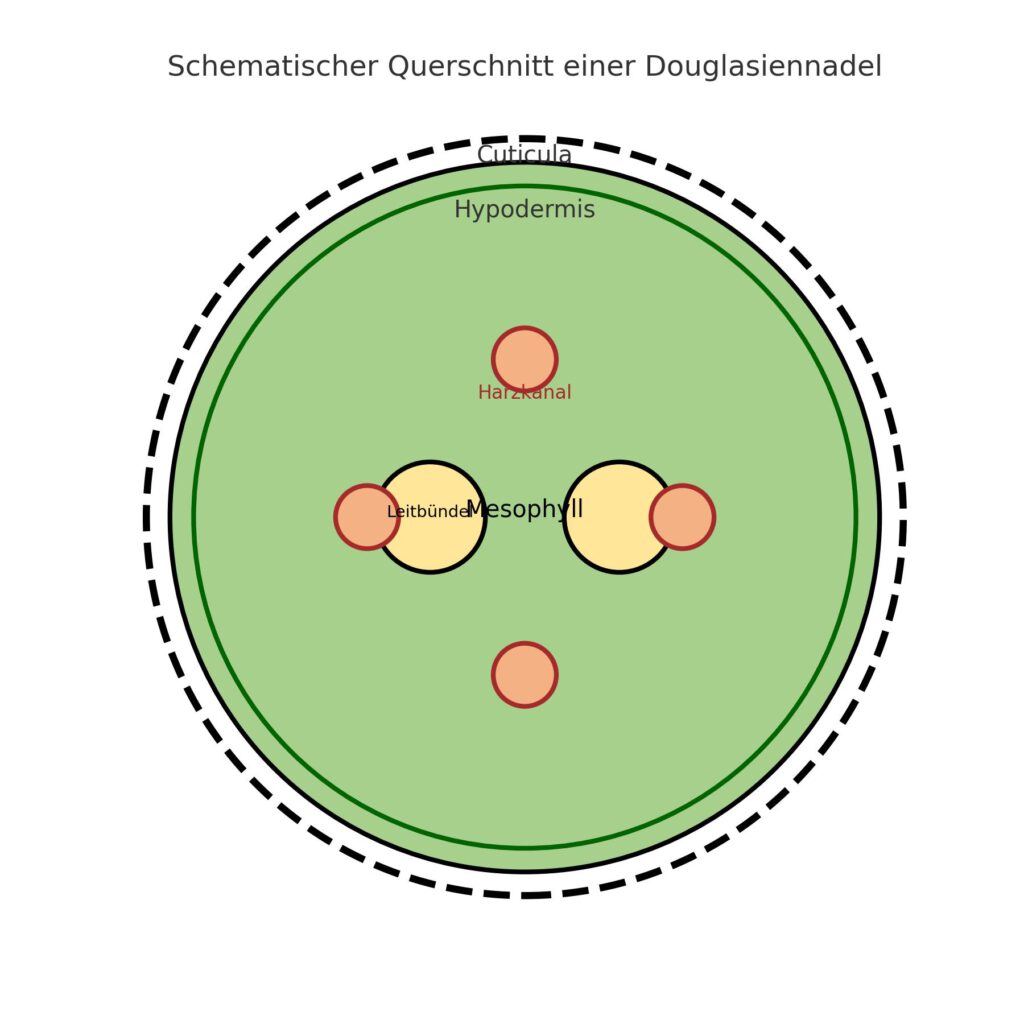In diesem Artikel geht es um das “Who is Who” derer, die sich dem Thema Wald- und Forst gesellschaftlich widmen. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir uns auf die bekanntesten Mietspieler konzentrieren.
Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) ist ein klassischer Umwelt- und Naturschutzverband mit starkem politischem und gesellschaftlichem Profil. Wälder betrachtet er primär als ökologische Ressource und als Teil übergeordneter Biodiversitäts- und Klimaschutzstrategien. Seine Positionierungen sind oftmals schutzgebietsorientiert, fordern eine stärkere Prozessschutzorientierung (d. h. die Ausweisung von Naturwäldern ohne forstliche Nutzung) und zielen auf eine ökosystemare Gesamtperspektive ab. Der BUND agiert stark advokatorisch gegenüber Politik und Gesellschaft, weniger jedoch innerhalb der praktischen forstlichen Bewirtschaftung.
Die ANW (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft e.V.) hingegen ist eine fachlich-professionelle Vereinigung von Forstleuten, Wissenschaftlern und Waldbesitzern, die sich dezidiert der waldbaulichen Praxis widmet. Ihr Leitbild ist das Konzept des Dauerwaldes nach Alfred Möller, das auf kontinuierliche Bestockung, Plenterungsprinzipien, standortgerechte Mischbaumartenwahl und die Selbstregulationsfähigkeit des Ökosystems setzt. Ziel ist eine ökologisch nachhaltige, aber zugleich ökonomisch tragfähige Form der Waldbewirtschaftung. Damit positioniert sich die ANW als forsttechnisch orientierte Reformbewegung innerhalb der Forstwirtschaft, die den Gegensatz zwischen rein ertragsorientierter Forstwirtschaft und strengem Naturschutz aufzulösen versucht.
Die SDW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.) schließlich fungiert primär als gesellschaftlich-vermittelnde Organisation im Bereich Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Während sie ebenfalls den Schutz des Waldes als Ziel formuliert, liegt ihr Schwerpunkt weniger auf forsttechnischen Diskursen oder politischer Lobbyarbeit, sondern auf der Sensibilisierung der Bevölkerung. Instrumente sind z. B. Baumpflanzaktionen, die Einrichtung von Schulwäldern, didaktische Programme und die symbolische Repräsentation des Waldes als Kulturgut. Sie agiert somit eher sozio-pädagogisch und versteht sich als Brücke zwischen Wald, Gesellschaft und nachwachsenden Generationen.
| Dimension | BUND | ANW | SDW |
| Zielgruppe | Politik, Gesellschaft, Öffentlichkeit, Umweltbewegung | Forstpraktiker, Waldbesitzer, Forstwissenschaftler | Allgemeinbevölkerung, Kinder & Jugendliche, Schulen |
| Handlungsfeld | Umwelt- und Naturschutz, politische Lobbyarbeit, Klimapolitik | Waldbauliche Praxis, nachhaltige Bewirtschaftung, Dauerwaldkonzepte | Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Pflanzaktionen |
| Leitbild | Umwelt- und Naturschutz, politische Lobbyarbeit, Klimapolitik | Dauerwald, naturnahe Waldwirtschaft, standortgerechte Mischwälder | Erhalt des Waldes als Kulturgut, Bewusstseinsbildung |
| Methodik | Kampagnen, Rechtsgutachten, politische Stellungnahmen, mediale Präsenz | Forstliche Leitlinien, praxisnahe Empfehlungen, Fachtagungen, Netzwerke | Baumpflanzaktionen, Schulwälder, pädagogische Projekte |
| Ausrichtung | Advokatorisch, ökologisch-strategisch | Forstlich-technisch, praxisorientiert | Pädagogisch, gesellschaftlich-vermittelnd |
| Zeithorizont | Langfristiger Schutz durch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen | Dauerhafte Waldentwicklung durch kontinuierliche Pflege und Nutzung | Bewusstsein und Bindung an den Wald in der nächsten Generation |